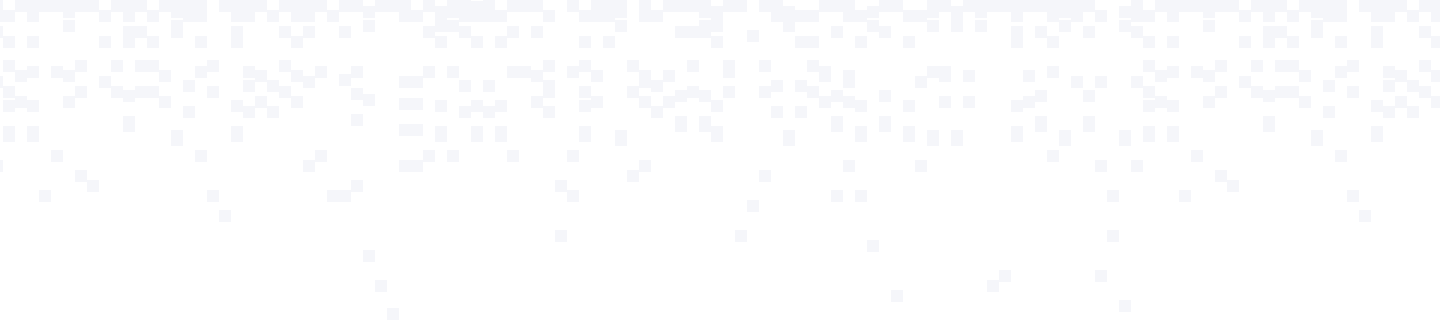Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Robert Seeber luden am 27. Jänner zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu einer Gedenkveranstaltung in die Wiener Börsensäle, bei der insbesondere der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau gedachte, die sich heuer zum 75. Male jährt.
Nach Bundesratspräsident Seeber sprach der Generalsekretär der IKG Wien Benjamin Nägele Worte des Gedenkens und über die Aufgaben, zu denen uns das Gedenken verpflichtet ."Der beste Kampf gegen antisemitische Vorurteile und Hass als auch die beste Art die Opfer der Shoah zu ehren und Ihrer zu gedenken, ist die Förderung von lebendiger facettenreicher jüdischer Kultur und jüdischem Leben in der Mitte der österreichischen Gesellschaft." Die Keynote des Abends kam von Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten). Sie sprach unter dem Titel Auschwitz bleibt uns anvertraut unter anderem über "Befreiung" und "Vermittlung".
Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau steht seit seiner Befreiung vor 75 Jahren durch die sowjetische Armee wie kein zweiter Ort für das unmenschlichste, aber doch von Menschen begangene Verbrechen der Geschichte – den Rassenwahn des Nazi-Regimes, der in der industriellen Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden endete.
Auschwitz. Dieses Vernichtungslager hätte auch das Todesurteil für Gisa Leshem besiegeln sollen. Meine Großmutter. Doch ihr Name, eingetragen auf der Liste von Oskar Schindler, rettete Ihr Leben. Jahrzehnte später steht sie vor der Klagemauer in Jerusalem, und feiert mit Ihrem Enkelsohn, feiert mit mir, meine Bar Mitzvah. Und sie sagt einen Satz, der mich, meinen Werdegang, und meine Persönlichkeit nachhaltig geprägt haben:
„In Auschwitz habe ich den Glauben an Gott verloren, habe verlernt zu weinen. Heute hier zu stehen, und die Bar Mitzvah meines Enkels zu feiern, heute hatte ich das erste Mal wieder Tränen in den Augen“
Die Signifikanz dieser Worte wurden mir erst Jahre später bewusst. Ihre Worte, Ihre Geschichte, Ihr Schicksal, ist mein täglicher Antrieb, das moralische Fundament meiner beruflichen Laufbahn, die Verbindung von Beruf und Berufung.
Es ist für mich die bedeutungsvollste, die schönste Art, ihr Andenken und ihr Erbe zu bewahren, indem ich an meine eigene Familiengeschichte und die unglaublich reiche Geschichte des österreichischem Judentums anknüpfen und am Wideraufblühen der jüdischen Gemeinde in Wien als Generalsekretär mitarbeiten darf.
Wien, das in den 30-er Jahren eine der größten jüdische Metropolen Europas war, eine Gemeinde mit rund 200.000 Mitgliedern. Ein lebendiger, stolzer, schöner, ein selbstverständlicher Teil Wiens und Österreichs, der spätestens mit den Novemberpogromen ein brutales Ende fand.
130.000 flohen oder wurden vertrieben, 65.000 wurden deportiert, fast genauso viele kamen ums Leben.
Trotzdem setzte die kleine jüdische Gemeinde nach der Shoah schon bald erste starke Lebenszeichen, 1963 mit der Wiedereröffnung des Stadttempels, 1972 mit der Errichtung des Maimonides Sanatoriums, 1984 mit der Wiedereröffnung der „Zwi-Perez-Chajes-Schule“.
Heute gibt es in Wien wieder junge Jüdinnen und Juden, die ihre Tradition pflegen und zugleich vielfältiges jüdisches Leben zu einem fixen Bestandteil unserer Gesellschaft machen. Es gibt Schulen, Kindergärten, zwei Dutzend Synagogen und Gebetsstuben, das psychosoziale Zentrum ESRA, Sportstätten, Seniorenheime.
Das vielfältige Spektrum jüdischen Lebens spiegelt sich auch in vielen Projekten wieder, von Likrat, wo jüdische Schüler und Studenten in Schulen gehen und den Dialog suchen, über das jüdische Kulturfestival oder den Tag der offenen Tür im Stadttempel. Die Jüdische Gemeinde Wien ist heute eine lebendige, selbstbewusste, inklusive Gemeinde, eine der wenigen Einheitsgemeinden in Europa. Ein Geschenk für Österreich und ein kleines Wunder:Doch neben der Modernisierung und Erhaltung der Infrastruktur, ist für die Kultusgemeinde der Kampf gegen Intoleranz und Judenhass eine immer größere Herausforderung. Bereits 1981 wurde die Gemeinde von einem Terroranschlag in der Seitenstettengasse erschüttert, 2 Menschen starben, 21 wurden verletzt.
Die Sicherheitsvorkehrungen vor den jüdischen Institutionen und Synagogen sind seitdem sehr hoch, jüdisches Leben ist bestimmt von Polizeischutz und hohen Mauern, fast 20 % unseres gesamten Budgets muss für Sicherheit aufgewendet werden.
Doch wie kann das sein? Wie kann es sein, dass es 75 Jahre nach der Shoah immer noch Judenhass gibt? Dass es ihn nicht nur gibt, sondern dass er steigt?
Was, wenn nicht die Auseinandersetzung mit den unfassbaren Gräueltaten hätte unsere Gesellschaft heilen müssen - von Antisemitismus, Rassismus, jeder Art der Diskriminierung, ein für alle Mal?
Das Wissen um die Shoah, ist keine Frage der Schuld, es ist eine Frage der Verantwortung.
Eine Verantwortung den Opfern der Shoah, ihren Hinterbliebenen, uns selbst, aber vor allem den nächsten Generationen gegenüber.
Meine Familiengeschichte, die Familiengeschichte von so vielen Gemeindemitgliedern der IKG ist ein Zeitzeugenbericht, ist für die jüdische Gemeinde Mahnung und Antrieb. Vergessen ist nicht möglich. Doch was ist mit der nichtjüdischen Bevölkerung?
Und was tun - wenn der letzte Überlebende, der letzte Zeuge der Shoah schon sehr bald verstummen wird?
Natürlich verschwindet mit dem Tod der Zeitzeugen nicht die Kenntnis über die Geschehnisse. Aber der Zugang zur Erinnerung und die Formen des Gedenkens werden sich trotzdem kontinuierlich verändern, und wir müssen lernen, damit umzugehen.
Denn ein erschreckend hoher Prozentsatz der jüngeren Generationen in Europa weist große Wissenslücken über die Vernichtung von 6 Millionen Juden auf sowie ein mangelndes Verständnis für die Vorgänge, die zur Shoah führten.
Dieses mangelnde Wissen trägt zu einer wachsenden Distanz gegenüber der eigenen Geschichte bei und ermöglicht letztlich ein Ansteigen von Antisemitismus.
Umso wichtiger ist es, die authentische Erinnerung und die individuellen Geschichten zu bewahren, den Bezug zu - und die Bedeutung für Österreich - für Wien - für Erinnerungs- und Gedenkorte vor allem mitten in und rund um unsere eigene Stadt, wie die vier Wiener Sammellager und Deportationszentren im Bezirk Leopoldstadt, zu bewahren und in die Erinnerungskultur einzubinden, sie vor allem den nächsten Generationen näherzubringen.
Was es zu mahnen gilt, ist das Unbegreifliche: Der Nationalsozialismus hat sich in atemberaubender Geschwindigkeit aus einer Demokratie heraus entwickelt, in wahnwitziger Geschwindigkeit aus einem Rechtsstaat eine industrielle Mordmaschinerie gemacht, über Landesgrenzen und Kontinente hinweg einen globalen Krieg entfacht.
Was es zu erinnern gilt, sind die individuellen Geschichten der Opfer des mörderischen Rassenwahns des Nationalsozialismus, die ermordeten Männer, Frauen und Kinder, Jüdinnen und Juden, Sinti- und Roma, Homosexuelle, behinderte und politisch-andersdenkende Menschen.
Aus beidem, aus Mahnung und Erinnerung, ergibt sich unsere Verantwortung: Die Verantwortung, die Opfer nicht zu vergessen, die Verantwortung, genau zu wissen, was passieren kann, wenn man Hass gewähren lässt, den Anfängen nicht wehrt.
Was während der Novemberpogrome, was in Dachau, in Mauthausen, was in Auschwitz, was während der Shoah geschah, das haben Menschen anderen Menschen angetan, haben es geschehen lassen, viele haben mitgemacht, und sehr viele haben weggeschaut.
Es darf keine Verfälschung, es darf kein Vergessen, es darf keinen Schlussstrich geben.
Im Kampf gegen Antisemitismus ist die Erinnerung an die Shoah Beweggrund und Motivation. Sie ist aber nur ein Aspekt eines großen Quersschnittsthemas, das von innerer Sicherheit, werteorientierter Bildung, Erziehungsfragen, und Integration fast alle gesellschaftlichen Bereiche abdeckt und betrifft.
Judenhass kommt aus allen Richtungen, aus allen Bildungs- und Einkommensschichten, von links, rechts, von Islamisten und leider immer häufiger auch aus der Mitte der Gesellschaft; Judenhass ist irrational und entbehrt jeglicher Logik. Er kann daher nicht allein nur mit Bildung bekämpft werden.
Wir vergleichen Antisemitismus häufig mit einem Virus, einem Krebsgeschwür, einer gesellschaftlichen Krankheit.
Doch Krankheit ist nicht selbstverschuldet. Jeglicher Hass, auch der gegen Juden, ist eine persönliche ganz bewusste Entscheidung eines jeden Einzelnen - und dementsprechend muss auch jeder Einzelne in die Verantwortung genommen werden, es darf unter keinen Umständen Ausreden, Beschönigungen, oder Bagatellisierungen geben.
Alles andere widerspricht unseren so hart erkämpften demokratischen Grundrechten und Freiheiten, und das muss für jeden gelten der in Österreich lebt, ungeachtet seiner Herkunft, seiner Religion, seiner politischen oder ethnischen Couleur.
Denn das antisemitische Krebsgeschwür, der Hass, er zerfrisst in letzter Konsequenz auch den Hassenden selbst und alles um ihn herum.
Ich bin 1984 in Deutschland geboren, habe den Umgang mit Geschichte und Erinnerung anders erlebt als in Österreich. Selbst in Deutschland herrschte lange Schweigen, bis im Zuge der 68-Bewegung endlich vieles aufgebrochen wurde. Österreich wiederum verharrte jahrelang im Opferstatus und zeigte keine Bereitschaft zur Mitverantwortung. Erst im Jahr 1993 kam es durch die Rede von Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky zu einer deutlichen Veränderung des Geschichtsbildes, indem an die Stelle der sogenannten „Opfer-These“ die „Mittäter-These“ trat.
Die darauffolgenden Jahre der Aufarbeitung der Geschichte und der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus haben in der Bevölkerung zu einer Sensibilisierung beigetragen. Einer Sensibilisierung gegenüber Intoleranz, Bedrohung oder Gewalt an Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder religiösen Überzeugung.
Es gibt kaum ein Land in Europa, das sich in den letzten Jahren so klar gegen Antisemitismus gestellt hat, an vorderster Front gegen Judenhass eintritt, und an der Seite des jüdischen Staates Israel steht, wie Österreich. Eine der ersten Regierungen, welche die Antisemitismus Definition der IHRA annahm, die einstimmig verabschiedete Deklaration unter österreichischer EU Ratspräsidentschaft speziell gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, und eine Regierung, die sich im neuen Regierungsprogramm nicht nur klar gegen Antisemitismus, sondern auch explizit gegen Antizionismus positioniert hat.
Doch wenn trotz alledem in Österreich wie in ganz Europa Judenhass wieder steigt, Jüdinnen und Juden nicht in Sicherheit leben können, dann machen wir etwas nicht richtig, oder zumindest machen wir nicht genug.
Wir alle müssen uns letztlich messen lassen an der Realität, und diese Realität sind nicht die Entschließungen des Nationalrates oder das Regierungsprogramm, auch nicht die ehrlichen und bewegenden Bekundungen am heutigen Gedenktag, sondern die anderen 364 Tage des Jahres, die Realität in den Schulen, den Universitäten, auf der Straße und in der U-Bahn.
Es sind die Beschimpfungen online und offline, es sind die antisemitischen Verschwörungstheorien, es sind die Höbelts an der Uni, es sind die unzähligen antisemitischen sogenannten Einzelfälle der FPÖ, die Boykottaufrufe gegen Israel, es sind die „Tod den Juden, Tod Israel“ Rufe bei pro palästinensischen Demos, und es ist die Notwendigkeit des bewaffneten Schutzes jeder einzelnen Synagoge und jüdischen Einrichtung in Österreich.
Die Tatsache, dass 75 Jahre nach Ende der Shoah, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, die österreichische Gesellschaft, die Zweite Republik, die als Anti-These zum Nationalsozialismus entstand, dass Österreich noch immer nicht befreit ist vom Judenhass, dass bewaffnete Polizisten vor den Synagogen stehen müssen, diese Tatsache ist beschämend und darf niemals als Normalität akzeptiert werden.
Der gemeinsame Kampf gegen Judenhass darf sich nicht auf Slogans beschränken, es müssen Taten gesetzt werden, das muss auch gelebt werden. Ich bin überzeugt, dass mit dem Willen etwas in unserer Gesellschaft zum Positiven zu verändern, auch vieles möglich sein kann. Es gibt eine tragfähige Basis, auf der aufgebaut werden kann, sei es im pädagogischen Bereich, auf bestimmten politischen Ebenen, im Kunst- und Kultursektor und vieles mehr.
Das von gegen Antisemitismus in Schulen, die Antisemitismus Erhebung, Schulklassenbesuche in Mauthausen, sind alles dringend notwendige und wichtige Schritte in die richtige Richtung, aber sie dürfen nur der Anfang sein.
Etwas was uns allen heute, in einer zunehmend digitalisierten und schnelllebigen Zeit schwer fällt, ist es, die Geduld aufzubringen und sich Zeit zu nehmen für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit gesellschaftlichen Problemen. Die Auseinandersetzung mit der Shoah endet nicht mit dem Abschluss eines Schulprojekts. Betroffenheit kann man nicht verordnen, Empathie lässt sich nicht in ein oder zwei Unterrichtseinheiten erlernen, Gedenken darf nicht zum Automatismus werden.
Es braucht Menschen in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen, die bereit sind als Vorbilder, als Mentoren oder Influencer in der Vermittlung von Werten, im Kampf gegen Antisemitismus und Hetze und im Kampf für demokratische Grundwerte einzutreten. Die Fähigkeit, Antisemitismus im Alltag zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren, muss gefördert werden.
Wer sich Antisemitismus und Extremismus nicht widersetzt, der verspielt nicht nur seine eigene Freiheit sondern setzt die Freiheit von uns allen aufs Spiel.
Der beste Kampf gegen antisemitische Vorurteile und Hass als auch die beste Art die Opfer der Shoah zu ehren und Ihrer zu gedenken, ist die Förderung von lebendiger facettenreicher jüdischer Kultur und jüdischem Leben in der Mitte der österreichischen Gesellschaft.
Ich denke, dass ich heute nicht alleine stehe mit dem Gefühl, dass für unsere Gesellschaft nun eine Zeit der Bewährung folgt:
Erinnerungskultur, Erziehung und Bildung sind nicht nur die Akkumulation von historischen Fakten, sie sind die Förderung einer werte-orientierten inneren Haltung, eines Gewissens. Das kann nicht einfach weitergereicht, das kann nicht vererbt werden, diese innere Haltung muss jede Generation, muss jeder einzelne, mühsam aufs Neue erarbeiten und verteidigen. In der Sekunde, in der wir unsere Freiheit, unsere Demokratie, unseren Frieden, für selbstverständlich nehmen, laufen wir Gefahr, dies alles wieder zu verlieren.
Gedenken an die Shoah muss eine Form dieser Willensbekundung sein, nicht nur gegen das Vergessen anzukämpfen sondern aktiv für jüdisches Leben und gegen jede Form von Judenhass und Diskriminierung jedweder Menschengruppen, für Toleranz und demokratische Werte einzutreten.
Dafür steht der heutige Gedenktag, und daran müssen wir alle gemeinsam täglich arbeiten.
Vielen Dank
Ein Bericht über die Gedenkveranstaltung am Heldenplatz sehen Sie unter anderem hier auf ORFIII
Über die Gedenkveranstaltung im Parlament können Sie unter anderem auf diepresse.com nachlesen.