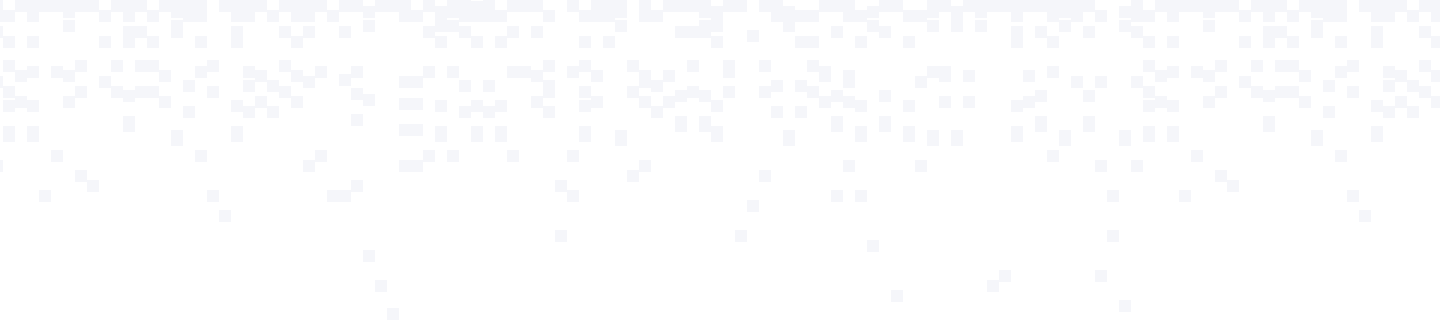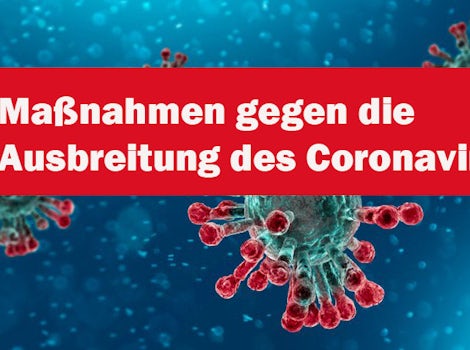Coronabedingt in kleinerem Rahmen als in den Vorjahren wurde am Mittwoch der diesjährige Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust durch das österreichische Parlament begangen. Im Palais Epstein diskutierten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die Schriftstellerin Jennifer Teege, der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz und Mitglied im Kultusvorstand der IKG Wien, Elie Rosen, und die Zeithistorikerin Barbara Stelzl-Marx unter dem Titel: „Zeit zum Reden“. Die Veranstaltung fand ohne Publikum statt und wurde vom ORF-Fernsehen übertragen.
[caption id="attachment_54624" align="alignright" width="297"]
 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) © Thomas Topf[/caption]
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) © Thomas Topf[/caption]Zu reden gab es denn auch einiges: der Themenbogen spannte sich von der individuellen Perspektive der eigenen Lebensgeschichte über den kollektiven Umgang Österreichs mit der NS-Vergangenheit bis zur Frage, wie heute mit Antisemitismus umzugehen sei. Sobotka unterstrich dabei vor allem auch den Aspekt der Verantwortung des heutigen Österreich.
„Wir sind es den ermordeten Jüdinnen und Juden schuldig, die Erinnerung an sie zu bewahren. Wir haben sechs Millionen Gründe zu gedenken. Es ist unser aller Erbe und damit auch Pflicht, im Namen der Opfer die Stimme zu erheben.“ Und: „Antisemitismus ist nicht nur eine Bedrohung für die Juden, sondern für die Demokratie und die offene Gesellschaft insgesamt.“ Jüdisches Leben, Kultur und Geschichte seien ein wichtiger Teil der Identität Österreichs. „Wir müssen jüdisches Leben sichtbarer machen, um Berührungsängste abzubauen.“
Sobotka selbst hat sich seiner Familiengeschichte gestellt. Einer seiner Großväter war NSDAP-Mitglied und Leiter der SA in Waidhofen an der Ybbs. Er sei nicht nur ein Mitläufer gewesen, erzählt der Enkel heute, das sei ihm etwa
[caption id="attachment_54614" align="alignleft" width="290"]
 Schriftstellerin Jennifer Teege © Thomas Topf[/caption]
Schriftstellerin Jennifer Teege © Thomas Topf[/caption]bei der Lektüre von Briefen des Großvaters klargeworden. Aus seinen Schreiben gehe hervor, dass er ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei. Ihn habe auch die Auseinandersetzung mit der Haltung seines Großvaters dazu bewogen, Geschichte zu studieren, so Sobotka. Auch die Schriftstellerin Teege kam über die Recherchen zu ihrem Großvater Amon Göth, einem SS-Mann und KZ-Kommandanten, zu dem Thema Nationalsozialismus und Aufklärung darüber, dem sie bis heute einen Großteil ihrer Arbeit widmet.
Rosen betonte, dass es heute nicht darum gehe, nachfolgenden Generationen Schuld zuzuschieben, sondern vielmehr darum, dass die aus der NS-Zeit resultierende Verantwortung anerkannt und wahrgenommen wurde. Aus seiner Sicht haben die Waldheim-Jahre hier eine Änderung des Diskurses gebracht. Warum lange nur über Opfer, nicht aber über Täter gesprochen wurde, sieht Stelzl-Marx in der „Moskauer Deklaration“ begründet. Mit ihr habe sich „eine regelrechte Doktrin von Österreich als dem ersten Opfer des Nationalsozialismus entwickelt“, konstatierte die Historikerin. Für viele Menschen sei es offenbar eine Erleichterung gewesen, dass sie sich als Opfer fühlen durften und sich nicht mit der Täterrolle auseinandersetzen mussten.
[caption id="attachment_54618" align="alignright" width="283"]
 Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen © Thomas Topf[/caption]
Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen © Thomas Topf[/caption]Der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz ging noch einen Schritt weiter: es seien mehrere Generationen sogar zum Schweigen über die Verbrechen des Nationalsozialismus erzogen worden. Dieses Schweigen zu durchbrechen, sei wichtig, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholen könne. Positiv merkte er an, dass seit den 1990er Jahren mehrere Regierungen in Österreich klare Zeichen gesetzt hätten – sowohl in der Frage der Aufarbeitung als auch jener der Entschädigung. Zuletzt hat die amtierende Regierung ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus vorgelegt.
Zu diesem Thema hielten sowohl Sobotka als auch Rosen fest, dass dieser einerseits immer auch in der Mitte der Gesellschaft war – der Nationalratspräsident verwies hier auch auf die Rolle der katholischen und evangelischen Kirche über die Jahrhunderte sowie der politischen Parteien - und andererseits nie verschwunden ist. Heute manifestiere er sich nur anders, betonte Rosen. Als Schüler sei er mit einer abfälligen Bemerkung eines Lehrers über das angebliche Suhlen in der Opferrolle konfrontiert gewesen. Als Präsident der jüdischen Gemeinde Graz sehe er vor allem Antisemitismus, der sich im Gewand der Israel-Kritik präsentierte und aus einem politisch linken Spektrum komme. Aber auch Social Media würden heute Möglichkeiten bieten, Hassbotschaften zu verbreiten.
[caption id="attachment_54610" align="alignleft" width="288"]
 Historikerin Barbara Stelzl-Marx © Thomas Topf[/caption]
Historikerin Barbara Stelzl-Marx © Thomas Topf[/caption]Stelzl-Marx verwies zudem auf ein Phänomen, das sich in der aktuellen Coronakrise immer öfter zeige: es würden unpassende Vergleiche zur NS-Zeit gezogen, dann etwa wenn ein Lockdown mit der Situation von Anne Frank oder der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen mit dem Engagement Sophie Scholls gleichgesetzt werden. Die Zeithistorikerin ist zwar der Ansicht, dass es hier vor allem um Provokation gehe. Allerdings bestehe auch die Gefahr der Relativierung des Nationalsozialismus. Auf diesen Trend würden wiederum rechtsradikale Gruppen aufspringen und antisemitisches Gedankengut erneut in die Mitte der Gesellschaft transportieren. Denn die Geschichte habe gezeigt: gerade in Extremsituationen würden Feindbilder geschaffen und es werde nach Sündenböcken gesucht.
Wichtig sei es daher, die Vergangenheit eben nicht zu vergessen. Es gebe immer weniger Zeitzeugen und Zeitzeuginnen – Stelzl-Marx appellierte daher, so möglich, auch innerhalb der Familie, noch möglichst viele Gespräche zu führen. Viele Zeitzeugeninterviews gebe es zudem bereits, entweder verschriftlich oder als Ton- oder Filmaufnahme digital, hier plädierte sie dafür, die verschiedensten Aufzeichnungen an einem Ort zusammenzuführen und so auch gesammelt der Forschung zugänglich zu machen.
Eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion ist in der Mediathek des Parlaments verfügbar.
(wea)