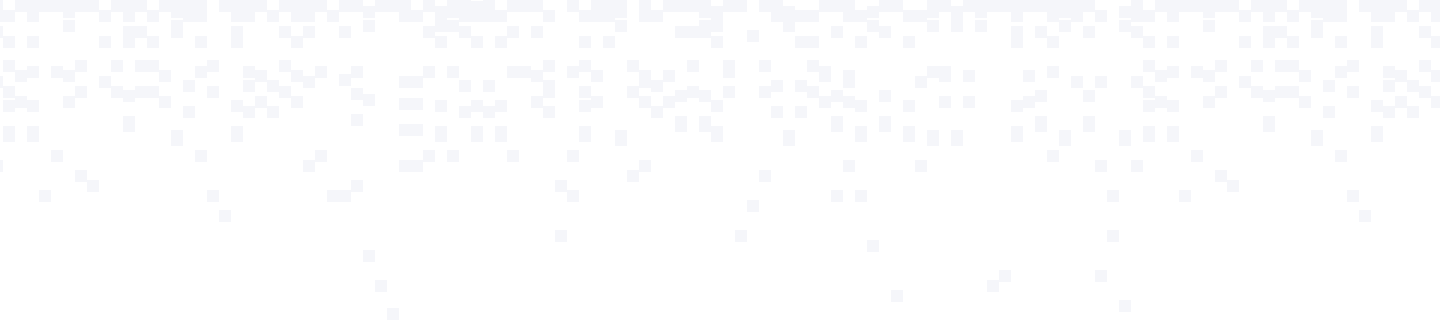Dies ist die Rede von IKG-Vizepräsidentin Claudia Prutscher in der Wiener Börse, im Rahmen der Gedenkveranstaltung der Regierung anläßlich des Internationalen Holocaustgedenktages am 27. Jänner. Gesprochen haben neben Vizepräsidentin Prutscher, PolitikerInnen und WissenschafterInnen.
[caption id="attachment_28848" align="aligncenter" width="500"] Begrüßung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Begrüßung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wen oder was haben Sie vor Augen, wenn Sie das Wort „Auschwitz“ hören? Oder Mauthausen? Oder Theresienstadt?
Würden wir eine Schweigeminute für jedes Opfer der Schoah abhalten, wäre es elf Jahre lang still.
Aber Statistik schafft kein Bewusstsein für die Dimension der industriellen Vernichtung der Juden.
Vor 74 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen befreit. Es war das größte KZ, aber die Fokussierung auf Auschwitz verstellt den Blick auf die Ursachen.
Die Schoah hat nicht in den Gaskammern begonnen. Am Anfang war der Hass, der Antisemitismus. Es folgten Ausgrenzung und Verfolgung.
Gedenken muss der Zukunft dienen. Deshalb ist der Kampf gegen Hass und Ausgrenzung das erste Gebot, das sich aus dem Holocaust-Gedenken ableitet. Aber nur wer die Geschichte kennt, kann Lehren daraus ziehen.
Wie also kann die Schoah vermittelt werden?
Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern, Begegnungen mit Überlebenden und der lehrplanmäßige Geschichtsunterricht sind wichtig, aber nicht ausreichend.
Qualität und Empathie entscheiden darüber, ob Bewusstsein geschaffen wird.
Im vorigen Jahr zeigte ein Lehrer in Deutschland eindrucksvoll, wie es gehen kann:
Im Mittelpunkt standen zwei deutsche Rapper, die für frauenverachtende und antisemitische Texte bekannt sind. In dem Lied „0815“ heißt es etwa: „… mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen.“
Die Rapper erhielten den Musikpreis Echo. Es hagelte Proteste, viele Künstler gaben ihre Echos zurück.
Unter jugendlichen Fans dieser Rapper wurde der Skandal anders wahrgenommen. Der Lehrer Jörg Heeb berichtete auf Facebook, wir er seine Klasse drüber aufgeklärt hat, dass die Textzeile mit den Auschwitzinsassen nicht „cool“ ist.
Zunächst stellte sich heraus, dass gar nicht allen klar war, was Auschwitzinsassen sind.
Also erklärte Jörg Heeb den Jugendlichen die Dimensionen des Massenmordes der Nazis an Juden.
Er projizierte dann zwei Fotos an die Leinwand:
Links das eines Bodybuilders mit definiertem Körper.
Rechts das eines abgemagerten Auschwitzinsassen.
Die Reaktionen waren entsprechend emotional. Der Text des Rappers sei geschmacklos, urteilte eine Schülerin, ein anderer meinte: "Der Bodybuilder quält sich freiwillig, der Mann aus Auschwitz wird von anderen gequält. Außerdem hat er keine Muskeln mehr. Der stirbt sicher bald."
Damit hat Jörg Heeb die Opfer geehrt und der Zukunft gedient.
Juden und Jüdinnen waren und sind Österreicher.
Eine von ihnen war Stella Klein-Löw, Mitglied der jüdischen Gemeinde – und sie war Nationalratsabgeordnete.
Sie leistete einen der wichtigsten Dienste, die es in einer aufgeklärten Gesellschaft gibt: Sie war Lehrerin.
Von den Nationalsozialisten verfolgt und aus Österreich vertrieben, kam Stella Klein-Löw trotzdem zurück nach Wien. Mehr noch: sie baute das moderne, demokratische Österreich mit auf. Als Jüdin, als Österreicherin, als Bildungspolitikerin.
Wenn wir heute die Rolle der Frauen betonen wollen, muss auch die Rolle der Nationalsozialistinnen beleuchtet werden. Dass es heute immer noch jene gibt, die Geschichts-Revisionismus betreiben und die Rolle von Nationalsozialistinnen schönreden, ist beschämend.
Nicht die Frauen, die wegen ihrer Unterstützung für die NSDAP ab 1945 von den Allierten dazu verpflichtet wurden, die Trümmer zu beseitigen, die der Faschismus verursacht hat, sind Heldinnen. – Nicht alle, aber viele waren Mittäterinnen und Mitläuferinnern im Nationalsozialismus.
Die Nazis haben Juden zu minderwertigen Lebewesen erklärt, zu Nichtösterreichern.
Die totale Vernichtung ist ihnen nicht gelungen, aber Auseinanderdividierung gibt es heute noch.
Damals hörten Juden immer wieder:
Ich höre und lese das auch heute noch.
Deshalb möchte ich Ihnen die Geschichte von Hannah erzählen:
Im Jahr 1938, im Alter von 5 Jahren musste Hannah mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter aus ihrer Heimatstadt Wien flüchten.
Nach Monaten auf der Flucht landeten sie in Kuba.
Hannas Großmutter Ella Schlesinger schaffte es nicht.
Sie wurde in Auschwitz ermordet.
Hannah war meine Mutter, Ella meine Urgroßmutter.
Nach 1945 kam für die drei Überlebenden nichts Anderes in Frage als die Rückkehr nach Wien. Trotzdem.
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis meine Mutter mit mir darüber geredet hat.
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis Österreich – damals war es Bundeskanzler Franz Vranitzky – die Mitschuld von so vielen Österreichern eingestanden hat.
Heute ist das anders – Vieles wurde aufgearbeitet und richtig gestellt.
Mein besonderer Dank gilt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der die jüdische Gemeinde ganz selbstverständlich als Teil Österreichs betrachtet und behandelt. Diese Gedenkveranstaltung ist ein Ausdruck für diese Geisteshaltung.
Jeder der sechs Millionen jüdischen Toten – und vergessen wir nicht die Roma und Sinti, behinderte Menschen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende – jede und jeder hatte ein Gesicht, einen Namen, eine Geschichte.
Der Nobelpreisträger und Schoah-Überlebende Elie Wiesel sagte: „Wer die Opfer vergisst, tötet sie ein zweites Mal.“
Auch deshalb gedenken wir der Opfer.
Dabei geht es nicht nur um Kranzniederlegungen und Reden.
Wer „Nie wieder!“ sagt, muss seine Stimme gegen jede Form von Antisemitismus erheben. Auch, wenn er in Form von Codes daherkommt: Die einen machen Soros zum Sündenbock, andere verunglimpfen den einzigen jüdischen Staat, die moderne Demokratie Israel, die uns wirklich ein „Nie Wieder!“ garantiert.
Informieren wir die Jugend dort, wo sie sich aufhält – und in einer Sprache, die die jungen Menschen sprechen.
Hören wir den Überlebenden zu, so lange wir sie haben und stehen wir auf gegen jede Form der Diskriminierung. Ob das auf Facebook ist, in den Schulen oder im Parlament:
Jeder von Ihnen ist ein Antisemitismusbeauftragter!
Jeder von Ihnen kann ein Anwalt der Toten sein. Verteidigen Sie sie, indem Sie den Versuchungen des Populismus widerstehen!
[caption id="attachment_28852" align="alignnone" width="500"] Lesung von Schauspielerin Ursula Strauss (li.), mit Karin Nusko, Mitarbeiterin am Institut für Wissenschaft und Kunst. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Lesung von Schauspielerin Ursula Strauss (li.), mit Karin Nusko, Mitarbeiterin am Institut für Wissenschaft und Kunst. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Einen ausführlichen Bericht der Kleinen Zeitung - Holocaust-Gedenken mit Kritik an Antisemitismus zur Veranstaltung finden Sie hier.
[caption id="attachment_28848" align="aligncenter" width="500"]
 Begrüßung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Begrüßung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]Sehr geehrte Damen und Herren!
Wen oder was haben Sie vor Augen, wenn Sie das Wort „Auschwitz“ hören? Oder Mauthausen? Oder Theresienstadt?
Würden wir eine Schweigeminute für jedes Opfer der Schoah abhalten, wäre es elf Jahre lang still.
Aber Statistik schafft kein Bewusstsein für die Dimension der industriellen Vernichtung der Juden.
Vor 74 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen befreit. Es war das größte KZ, aber die Fokussierung auf Auschwitz verstellt den Blick auf die Ursachen.
Die Schoah hat nicht in den Gaskammern begonnen. Am Anfang war der Hass, der Antisemitismus. Es folgten Ausgrenzung und Verfolgung.
Gedenken muss der Zukunft dienen. Deshalb ist der Kampf gegen Hass und Ausgrenzung das erste Gebot, das sich aus dem Holocaust-Gedenken ableitet. Aber nur wer die Geschichte kennt, kann Lehren daraus ziehen.
Wie also kann die Schoah vermittelt werden?
Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern, Begegnungen mit Überlebenden und der lehrplanmäßige Geschichtsunterricht sind wichtig, aber nicht ausreichend.
Qualität und Empathie entscheiden darüber, ob Bewusstsein geschaffen wird.
Im vorigen Jahr zeigte ein Lehrer in Deutschland eindrucksvoll, wie es gehen kann:
Im Mittelpunkt standen zwei deutsche Rapper, die für frauenverachtende und antisemitische Texte bekannt sind. In dem Lied „0815“ heißt es etwa: „… mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen.“
Die Rapper erhielten den Musikpreis Echo. Es hagelte Proteste, viele Künstler gaben ihre Echos zurück.
Unter jugendlichen Fans dieser Rapper wurde der Skandal anders wahrgenommen. Der Lehrer Jörg Heeb berichtete auf Facebook, wir er seine Klasse drüber aufgeklärt hat, dass die Textzeile mit den Auschwitzinsassen nicht „cool“ ist.
Zunächst stellte sich heraus, dass gar nicht allen klar war, was Auschwitzinsassen sind.
Also erklärte Jörg Heeb den Jugendlichen die Dimensionen des Massenmordes der Nazis an Juden.
Er projizierte dann zwei Fotos an die Leinwand:
Links das eines Bodybuilders mit definiertem Körper.
Rechts das eines abgemagerten Auschwitzinsassen.
Die Reaktionen waren entsprechend emotional. Der Text des Rappers sei geschmacklos, urteilte eine Schülerin, ein anderer meinte: "Der Bodybuilder quält sich freiwillig, der Mann aus Auschwitz wird von anderen gequält. Außerdem hat er keine Muskeln mehr. Der stirbt sicher bald."
Damit hat Jörg Heeb die Opfer geehrt und der Zukunft gedient.
Juden und Jüdinnen waren und sind Österreicher.
Eine von ihnen war Stella Klein-Löw, Mitglied der jüdischen Gemeinde – und sie war Nationalratsabgeordnete.
Sie leistete einen der wichtigsten Dienste, die es in einer aufgeklärten Gesellschaft gibt: Sie war Lehrerin.
Von den Nationalsozialisten verfolgt und aus Österreich vertrieben, kam Stella Klein-Löw trotzdem zurück nach Wien. Mehr noch: sie baute das moderne, demokratische Österreich mit auf. Als Jüdin, als Österreicherin, als Bildungspolitikerin.
Wenn wir heute die Rolle der Frauen betonen wollen, muss auch die Rolle der Nationalsozialistinnen beleuchtet werden. Dass es heute immer noch jene gibt, die Geschichts-Revisionismus betreiben und die Rolle von Nationalsozialistinnen schönreden, ist beschämend.
Nicht die Frauen, die wegen ihrer Unterstützung für die NSDAP ab 1945 von den Allierten dazu verpflichtet wurden, die Trümmer zu beseitigen, die der Faschismus verursacht hat, sind Heldinnen. – Nicht alle, aber viele waren Mittäterinnen und Mitläuferinnern im Nationalsozialismus.
Die Nazis haben Juden zu minderwertigen Lebewesen erklärt, zu Nichtösterreichern.
Die totale Vernichtung ist ihnen nicht gelungen, aber Auseinanderdividierung gibt es heute noch.
Damals hörten Juden immer wieder:
„Wenn’s euch nicht passt, könnt ihr Österreich verlassen“
Ich höre und lese das auch heute noch.
Deshalb möchte ich Ihnen die Geschichte von Hannah erzählen:
Im Jahr 1938, im Alter von 5 Jahren musste Hannah mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter aus ihrer Heimatstadt Wien flüchten.
Nach Monaten auf der Flucht landeten sie in Kuba.
Hannas Großmutter Ella Schlesinger schaffte es nicht.
Sie wurde in Auschwitz ermordet.
Hannah war meine Mutter, Ella meine Urgroßmutter.
Nach 1945 kam für die drei Überlebenden nichts Anderes in Frage als die Rückkehr nach Wien. Trotzdem.
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis meine Mutter mit mir darüber geredet hat.
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis Österreich – damals war es Bundeskanzler Franz Vranitzky – die Mitschuld von so vielen Österreichern eingestanden hat.
Heute ist das anders – Vieles wurde aufgearbeitet und richtig gestellt.
Mein besonderer Dank gilt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der die jüdische Gemeinde ganz selbstverständlich als Teil Österreichs betrachtet und behandelt. Diese Gedenkveranstaltung ist ein Ausdruck für diese Geisteshaltung.
Jeder der sechs Millionen jüdischen Toten – und vergessen wir nicht die Roma und Sinti, behinderte Menschen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende – jede und jeder hatte ein Gesicht, einen Namen, eine Geschichte.
Der Nobelpreisträger und Schoah-Überlebende Elie Wiesel sagte: „Wer die Opfer vergisst, tötet sie ein zweites Mal.“
Auch deshalb gedenken wir der Opfer.
Dabei geht es nicht nur um Kranzniederlegungen und Reden.
Wer „Nie wieder!“ sagt, muss seine Stimme gegen jede Form von Antisemitismus erheben. Auch, wenn er in Form von Codes daherkommt: Die einen machen Soros zum Sündenbock, andere verunglimpfen den einzigen jüdischen Staat, die moderne Demokratie Israel, die uns wirklich ein „Nie Wieder!“ garantiert.
Informieren wir die Jugend dort, wo sie sich aufhält – und in einer Sprache, die die jungen Menschen sprechen.
Hören wir den Überlebenden zu, so lange wir sie haben und stehen wir auf gegen jede Form der Diskriminierung. Ob das auf Facebook ist, in den Schulen oder im Parlament:
Jeder von Ihnen ist ein Antisemitismusbeauftragter!
Jeder von Ihnen kann ein Anwalt der Toten sein. Verteidigen Sie sie, indem Sie den Versuchungen des Populismus widerstehen!
[caption id="attachment_28852" align="alignnone" width="500"]
 Lesung von Schauspielerin Ursula Strauss (li.), mit Karin Nusko, Mitarbeiterin am Institut für Wissenschaft und Kunst. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]
Lesung von Schauspielerin Ursula Strauss (li.), mit Karin Nusko, Mitarbeiterin am Institut für Wissenschaft und Kunst. (© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner)[/caption]Einen ausführlichen Bericht der Kleinen Zeitung - Holocaust-Gedenken mit Kritik an Antisemitismus zur Veranstaltung finden Sie hier.