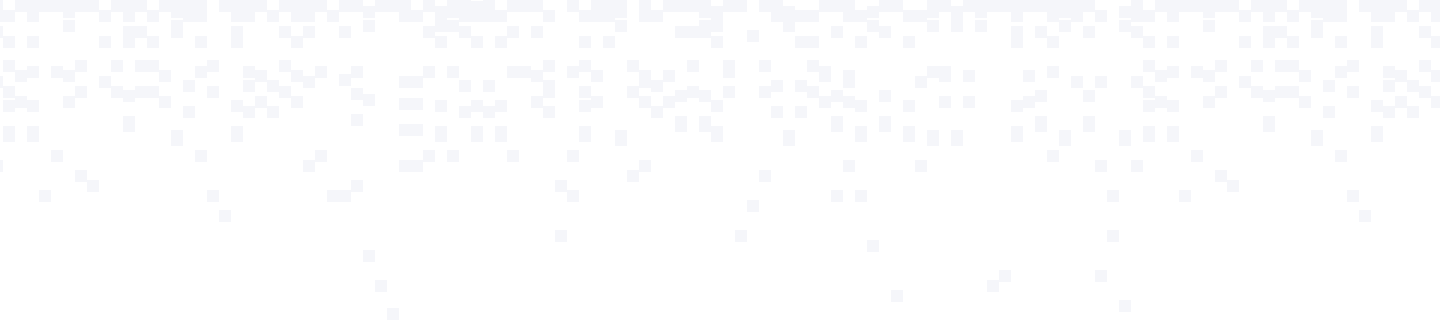Die Schweizer Gamaraal Foundation ist im Parlament mit dem Hauptpreis des Simon-Wiesenthal-Preises 2024 ausgezeichnet worden. Der Zweite Präsident des Nationalrates, Peter Haubner, betonte in seiner Eröffnungsrede, Antisemitismus sei nicht überwunden und „bittere Realität“ der Gegenwart. Er dürfe aber weder heute noch morgen einen Platz in Österreich, in Europa noch anderswo haben. In einer Welt, in der antisemitische Stereotype wieder salonfähig würden und Verschwörungserzählungen neue Blüten trieben, brauche es Menschen, „die aufstehen anstatt wegzusehen“. Die Preisträgerinnen und Preisträger seien genau solche Menschen, die die Erinnerung an die Schoah lebendig hielten.
Die Gamaraal Foundation, gegründet von Anita Winter, engagiert sich für die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden und Bildungsarbeit. Winter erklärte: „Es werde eine Mauer gegen Hass geschaffen, wenn die Stimme und Geschichte der Überlebenden weiter getragen werde, denn Bildung sei nicht nur Wissensvermittlung, sondern ‚Herzensbildung‘.“ Jury-Vorsitzende und EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein würdigte die Initiative mit den Worten: Man könne nicht die Vergangenheit, aber sehr wohl die Gegenwart ändern.
Weitere Auszeichnungen gingen an die britische Organisation Community Security Trust für ihr Engagement gegen Antisemitismus sowie an den burgenländischen Verein RE.F.U.G.I.U.S. für seine Arbeit in der Holocaust-Aufklärung. Jury-Mitglied Ariel Muzicant sagte, jüdische Menschen wollten weder als Opfer gesehen noch bemitleidet werden. Der Community Security Trust sei ein Modell für jüdischen Selbstschutz. Dessen Vertreter Jonny Newton erläuterte, die Organisation schütze jüdische Gemeinden vor Antisemitismus.
Auch neun Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wurden geehrt. Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds, erklärte, viele Überlebende gäben ihre Erfahrungen bis heute weiter und ermöglichten so Menschen, Geschichte „aus dieser besonderen Quelle“ zu erfahren. Für Vorständin Judith Pfeffer ist Erinnerung „nicht bloß eine Rückschau, sondern ein Auftrag“. Jede der 229 Einreichungen sei „ein starkes Zeichen für Zivilcourage, für Haltung und der Hoffnung“.